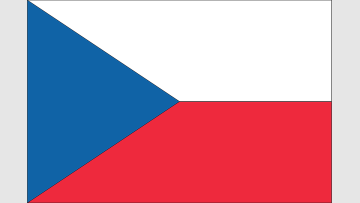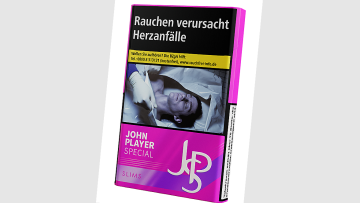Kolben, Lager, Kurbelwelle, Ventile – ein Verbrennungsmotor besitzt viele bewegte Teile, die alle geschmiert werden wollen. Dazu fördert eine Pumpe das Öl in alle wichtigen Bereiche des Motors. Es bildet dort einen hauchdünnen Schutzfilm und sorgt dafür, dass sich die beweglichen Metallteile geschmeidig aneinander vorbei bewegen, statt sich gegenseitig abzunutzen. Außerdem transportiert Öl Wärme ab, hält den Motor sauber und schützt vor Korrosion. Kurz gesagt: Ohne Öl würde der Motor in kürzester Zeit seinen Dienst quittieren.
All das ist nichts Neues – seit 100 Jahren erklären Dekra-Experten Autofahrern die Technik von Fahrzeugen. So schrieb die "DEKRA Zeitschrift" schon 1928: "Dieser Oelfilm ist von außerordentlich geringer Stärke – wenige hundertstel Millimeter –, da ja die Passungen in den modernen Fabrikationsverfahren, die einen möglichst geräuschlosen Gang der Motoren erzielen wollen, mit Toleranzen von wenigen hundertsteln Millimetern arbeiten. […] Ein Oelmangel kann zu den schwersten Beschädigungen des Motors führen, eine richtige Beschickung des Motors mit geeignetem Oel ist daher als einer der wichtigsten Punkte bei der Pflege des ganzen Wagens überhaupt zu bezeichnen."
Seit den 1920er Jahren hat sich daran nichts Grundlegendes geändert, auch wenn sich sowohl die Motoren als auch die Öle seitdem bedeutend weiterentwickelt haben.
Welche Ölsorten gibt es?
Die Welt der Motoröle teilt sich heute in drei grundlegende Kategorien, die sich im Wesentlichen durch ihre Herstellungsverfahren unterscheiden:
- Mineralöl besteht im Grunde aus natürlichen Rohölraffinaten.
- Synthetik-Öl wird ebenfalls in großen Industrieanlagen meist aus Erdgas-Bestandteilen hergestellt.
- Teilsynthetik-Öl ist in der Regel eine Mischung aus beiden.
In allen drei Kategorien gibt es unterschiedliche Qualitäten. Verbraucher sollten auf Markenhersteller achten und sich in einschlägigen Tests von Fachzeitschriften oder -portalen informieren.
Was bedeuten die vielen Abkürzungen?
Fahrzeughersteller geben genau vor, welches Öl verwendet werden muss. Die Sorte hängt von Motor und Leistung ab, aber auch von Klima der Region, in der das Auto gefahren wird. Alle diese Informationen stehen im Fahrzeughandbuch.
Grundsätzlich muss das Öl dünnflüssig genug sein, um alle Teile sofort beim Motorstart zu schützen. Aber jeder Schmierstoff ist nur für einen bestimmten Temperaturbereich ausgelegt, den man anhand des SAE-Wertes erkennt (z.B. 10W-50). Er informiert über die Viskosität der Flüssigkeit, also ihre Fließfähigkeit. Dabei steht das "W" für Winter. Die Zahl vor dem "W" informiert über die niedrigste Temperatur, in der das Öl eingesetzt werden kann. Je kleiner die Zahl, desto besser eignet sich das Öl für den Einsatz in kalten Regionen. Die Ziffern hinter dem "W" beschreiben die Fließfähigkeit des Öls bei 100°C.
Jeder Motor ist auf einen bestimmten Viskositätsbereich eingestellt und braucht deshalb das passende Öl. Fast alle Fahrzeughersteller haben inzwischen eigene Bezeichnungen und Standards für Öle, die ihren jeweiligen Vorgaben entsprechen. Diese Vorgaben und Bezeichnungen stehen im Fahrzeughandbuch bzw. auf dem Ölbehälter im Handel.
Daneben müssen Motoröle weitere Spezifikationen erfüllen. Dazu gehören zum Beispiel die vom Verband der europäischen Automobilhersteller festgelegten ACEA-Vorgaben oder die des amerikanischen API.
Ein Long-Life-Öl ist in der Regel teurer, verlängert aber die Wartungsintervalle auf bis zu 30.000 Kilometer, was langfristig Kosten sparen kann. Wichtig ist aber auch hier, die Herstellervorgaben genau zu beachten.
Von solchen Ölwechsel-Intervallen war die Technik 1928 noch weit entfernt, wie die "DEKRA Zeitschrift" beschreibt: "Als Richtzahlen für den Ölwechsel seien die nachfolgenden genannt: bei neueren Motoren nach den ersten 500 km, dann nach weiteren 750 km, dann nach je 1.000 bis 1.500 km."
Kann man Auto-Öl im Motorrad verwenden?
Viele Motorräder haben ein gemeinsames Schmiersystem für Motor, Getriebe und Kupplung. Daher enthalten Motorrad-Öle spezielle Additive, die die Nasskupplung nicht beeinträchtigen. Das falsche Öl lässt die Kupplung rutschen oder schneller verschleißen.
Öl nachfüllen – aber richtig!
Kontrollieren Sie den Ölstand unbedingt immer bei warmem Motor. Das Auto sollte ein, zwei Minuten auf einer gerade Fläche stehen, damit sich das Öl unten sammelt. Am Ölpeilstab muss sich der Pegel zwischen den beiden Markierungen befinden. Wenn der Ölstand niedrig ist, muss vorsichtig das richtige Öl nachgefüllt werden. Die Einfüllöffnung befindet sich meist oben am Motor, der drehbare Deckel ist oft mit einer Ölkanne gekennzeichnet. Das Öl langsam und am besten mithilfe eines Trichters auffüllen, damit nichts daneben tropft. Lassen Sie es etwas setzen, dann Peilstab abwischen und nachkontrollieren.
Achtung: Niemals zu viel einfüllen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Kurbelwelle ins Öl eintaucht, was sie eigentlich nicht soll. Dann passiert etwas Ähnliches wie mit dem Handmixer, mit dem man zum Beispiel Eiweiß schaumig schlägt: Das Öl schäumt auf und kann deshalb seine Aufgabe, den Motor zu schmieren, nicht mehr richtig erfüllen.
Übrigens dürfen zwar Öle unterschiedlicher Hersteller miteinander gemischt werden, aber nur solange sie die gleichen Spezifikationen aufweisen. Unterschiedliche Viskositäten und Spezifikationen nicht mischen!

Wie oft muss man Ölstand kontrollieren?
In vielen modernen Fahrzeugen überwachen Sensoren den Ölstand und warnen über eine Anzeige im Cockpit. Darauf sollte man sich aber nicht ausschließlich verlassen, sondern den Ölstand regelmäßig (spätestens alle 1.000 Kilometer) manuell prüfen.
Was passiert bei zu niedrigem Ölstand?
Bei zu niedrigem Ölstand leuchtet in der Regel die Ölkontrollleuchte. Auch ungewöhnliche Motorgeräusche wie Klappern oder Rasseln oder plötzlicher Leistungsverlust sind möglich. Dann in jedem Fall den Wagen so schnell wie möglich abstellen und Ölstand prüfen, um Schäden zu vermeiden.
Kann man das Öl selbst wechseln?
Theoretisch ja, sofern man die nötige Kenntnis und das passende Werkzeug hat. Allerdings muss bei modernen Autos auch die Wartungsanzeige zurückgestellt werden. Wichtig: Motoröl ist extrem umweltschädlich und darf auf keinen Fall ins Abwasser oder in den Hausmüll gelangen. Sie können das Altöl kostenlos dort zurückgeben, wo Sie das Öl gekauft haben. Auch Werkstätten und Recyclinghöfe nehmen oft Altöl an, meist gegen eine kleine Gebühr.
Fazit: Wenig Aufwand, große Wirkung
Den Ölstand zu prüfen ist kein Hexenwerk und lässt sich schnell während des Tankens erledigen. Der Motor bedankt sich für die Pflege mit einer längeren Lebensdauer. Auch darauf wies Dekra schon 1928 hin – und zwar speziell die angestellten Chauffeure: "Wie oft wird bei der Schmierung des Kraftwagens gesündigt, aus Nachlässigkeit und Faulheit, aber auch vielfach aus Unkenntnis. Den erstgenannten Sündern möchte ich zurufen: Geht in euch, überlegt euch, welchen Schaden Ihr eurem Brotgeber zufügt, wenn Ihr aus purer Nachlässigkeit eure Pflicht gröblich verletzt."