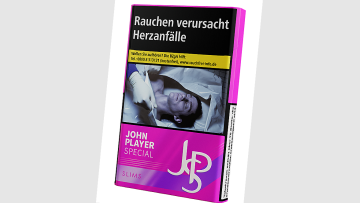Ob Industrie, Verkehr oder Stromerzeugung – Wasserstoff wird in vielen Bereichen als Lösung gesehen. Grüner Wasserstoff, hergestellt durch Elektrolyse mit erneuerbarem Strom, könnte Stahlwerke dekarbonisieren, Flugzeuge, Lkw und Busse antreiben oder als Energiespeicher für windstille Tage dienen. Bis 2030 soll in der EU die Produktion von grünem Wasserstoff auf zehn Millionen Tonnen pro Jahr steigen, betonen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und andere Politiker regelmäßig. Auch Deutschland hat mit seiner nationalen Wasserstoffstrategie ambitionierte Ziele formuliert: Bis 2030 sollen Elektrolyseure mit einer Gesamtleistung von zehn Gigawatt in Betrieb gehen.
Doch ein Blick auf den Status quo zeigt: Die Vision ist noch weit von der Realität entfernt. Der Anteil von grünem Wasserstoff an der globalen Produktion von Wasserstoff liegt derzeit bei weniger als einem Prozent. Ein Grund dafür sind die enormen Kosten, die mit der Herstellung und Nutzung von Wasserstoff verbunden sind.
Hohe Kosten als zentrale Bremse
Einer der größten Stolpersteine ist die Wirtschaftlichkeit von grünem Wasserstoff. Während Wasserstoff aus fossilen Brennstoffen (grauer oder blauer Wasserstoff) vergleichsweise günstig produziert werden kann, ist klimafreundlicher, durch Elektrolyse gewonnener Wasserstoff (grüner Wasserstoff) derzeit deutlich teurer. Grauer Wasserstoff – unter anderem gewonnen aus Erdgas – ist für etwa 1,50 Euro pro Kilogramm erhältlich. Grüner Wasserstoff hingegen kostet aktuell 5 bis 10 Euro pro Kilogramm. Die Herstellung erfordert enorme Mengen an erneuerbarer Energie, die vielerorts noch nicht in ausreichendem Maße verfügbar ist.
Stefan Schwarzer ist Geschäftsführer von H2now. Mit seinem Mittelstandsnetzwerk will er ein flächendeckendes Wasserstoff-Tankstellennetz aufbauen. Schwarzer sieht aber gegenwärtig zu geringe Produktionskapazitäten auf nationaler Ebene und schreibt Wasserstoffimporten aus Südeuropa, Nordafrika und Australien künftig eine wichtige Rolle in der Produktion klimafreundlicher Energie zu.
Dass grüner Wasserstoff so teuer ist, hat mehrere Gründe. Dazu gehören die hohen Strompreise. Die Elektrolyse benötigt enorme Mengen an Strom. In vielen Ländern ist erneuerbarer Strom aber noch nicht günstig genug verfügbar. Ein weiteres Problem ist die geringe Skalierung. Die Produktion grünen Wasserstoffs steckt noch in den Kinderschuhen und ohne große Anlagen bleiben die Kosten hoch. Außerdem fehlt die CO2-Bepreisung. Fossiler Wasserstoff ist auch deshalb günstig, weil die Umweltauswirkungen nicht ausreichend eingepreist sind.
Langfristig könnten fallende Kosten für erneuerbare Energien und Skaleneffekte die Preise senken. Doch kurzfristig bleibt die Finanzierung ein zentrales Problem.
Unternehmen steigen nicht freiwillig um
Unternehmen steigen kaum freiwillig um, solange fossile Alternativen günstiger sind. Solar- und Windkraftanlagen sind zwar inzwischen kostengünstiger geworden, doch für eine nachhaltige Wasserstoffproduktion müssen deutlich mehr Kapazitäten geschaffen werden. Darüber hinaus ist der Umwandlungsprozess ineffizient. Der Energieverlust bei der Elektrolyse und der nachfolgenden Nutzung von Wasserstoff liegt oft bei über 30 Prozent.
Die Bundesregierung ist aufgefordert, den Ausbau der Infrastruktur aktiv mit zielgerichteten Subventionen von Brennstoffzellenfahrzeugen und Wasserstoff Tankstellen zu unterstützen und die THG-Quoten über 2030 hinaus verlässlich zu regeln, so Schwarzer. Er macht ebenso unverlässliche politische Rahmenbedingungen für Probleme im Markthochlauf verantwortlich. Ein gutes Beispiel für vermeidbare Probleme im Markthochlauf sei die unterschiedliche Energiebesteuerung von Fahrzeugen mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor und Brennstoffzellenantrieb.
Fehlende Infrastruktur
Ein weiteres zentrales Hindernis ist die noch unzureichende Infrastruktur. Um Wasserstoff effizient zu transportieren und zu lagern, braucht es das nationale Wasserstoffkernnetz mit Pipelines, Speicher sowie eine ausreichende Anzahl an Ausspeisepunkten für die Versorgung der nationalen Wasserstoff Tankstellen, erklärt Schwarzer.
Doch der Ausbau schreitet nur schleppend voran. In Deutschland gibt es derzeit nur eine Handvoll Wasserstoff Tankstellen für den Schwerlastverkehr, und der Transport per Lkw oder Schiff ist teuer und ineffizient. Der Bau von Elektrolyseuren, Pipelines und Lagermöglichkeiten ist teuer und erfordert Zeit.
Laut Schwarzer sei der Ausbau der Tankstellen-Infrastruktur immer noch mit Hürden verbunden. Gerade Unternehmen im Logistikbereich scheuen die derzeit hohen Investitionen in noch teure Wasserstofffahrzeuge. Wichtig sei, dass die Fahrzeughersteller möglichst schnell die angekündigten Wasserstofffahrzeuge in hohen Stückzahlen bereitstellen. Gleichzeitig müsse der Wasserstoffimport weiter vorangetrieben werden.
Der Transport von Wasserstoff birgt technische Herausforderungen. In komprimierter Form benötigt er spezielle Tanks, die hohen Druck aushalten. Alternativ kann Wasserstoff verflüssigt werden. Aber das erfordert extrem niedrige Temperaturen und zusätzliche Energie.
Wasserstoff braucht eine völlig neue Infrastruktur – von der Produktion über den Transport bis hin zur Nutzung. Deutschland plant zwar den Ausbau eines Wasserstoffnetzes mit etwa 9.000 Kilometern bis 2032, aber bisher geht der Ausbau nur schleppend dahin. Es gibt massive Lücken. Das beginnt schon damit, dass es zu wenig Elektrolyseure gibt und die Produktionskapazitäten viel zu gering sind. Laut Hydrogen Council waren Ende 2023 weltweit mehr als ein Gigawatt Elektrolysekapazität im Einsatz – nötig wären Hunderte Gigawatt.
Dann fehlen die Transportmöglichkeiten. Wasserstoff lässt sich nur schwer speichern und transportieren. Pipelines und unterirdische Speicher sind im Aufbau, der Transport in flüssiger Form ist jedoch aufwendig und teuer. Und schließlich gibt es bislang nur unzureichende Nutzungsmöglichkeiten. Viele Industrieunternehmen sind noch nicht auf Wasserstoff umgestellt, und im Verkehrssektor fehlen Tankstellen für Wasserstoff-Fahrzeuge.
Deutschland ist zu undiszipliniert
Ein europäisches Förderprogramm und politische Absichtserklärungen gibt es, doch es fehlt an einer konsequenten Umsetzung, so Schwarzer. Und unterschiedliche Länder setzen auf verschiedene Standards und Regularien. Dieser regulatorische Flickenteppich erschwert den schnellen Infrastrukturaufbau. Schwarzer sieht Europa in der Wasserstoffwirtschaft hinter Ländern wie Japan, Australien oder China zurück. Diese Länder investieren gezielter. Die Bundesrepublik sei hier nicht diszipliniert genug und es komme immer wieder zu Aufschiebungen aufgrund des Stopfens von Haushaltslöchern oder anderer politischer Agenden.
Viele Betriebe warten, anstatt proaktiv in Wasserstofftechnologien zu investieren. Es fehlt an Anreizen. Von vielen Seiten wird daher ein entschlosseneres Handeln der Politik gefordert, etwa durch eine stärkere CO2-Bepreisung oder verpflichtende Wasserstoffquoten in bestimmten Sektoren.
Politisch wird viel von Förderungen gesprochen, doch stellt sich die Frage, ob dies auch entschlossen genug umgesetzt wird. Es gibt zwar viele Lippenbekenntnisse zur Wasserstoffstrategie, doch in der Praxis hakt es an der Umsetzung: Zum einen fließen Fördermittel langsam. Zwar gibt es milliardenschwere Förderprogramme, doch bürokratische Hürden und lange Genehmigungsverfahren bremsen Investitionen aus. Zum anderen sind die Prioritäten unklar. Während einige Länder auf eine heimische Wasserstoffproduktion setzen, wollen andere vor allem Wasserstoff importieren – etwa aus Afrika oder dem Nahen Osten. Diese Unsicherheit hemmt Investoren.
Vorteile bietet Wasserstoff durchaus
Dennoch sieht Schwarzer enorme Vorteile für die Zukunft des grünen Wasserstoffs: Sehr kurze Tankzeiten von Bussen und Lkw von nur etwa 15 Minuten würden eine hohe Fahrzeugverfügbarkeit bieten, und insbesondere die großen Reichweiten würden die Mobilität des Schwerverkehrs und des ÖPNV mit grünem Wasserstoff attraktiv machen.
Es gilt optimistisch zu bleiben, da der Durchbruch kommen wird, aber nicht von heute auf morgen. Wir brauchen eine kluge Mischung aus Förderung, internationaler Zusammenarbeit und Innovationsdruck. Dann kann Wasserstoff eine echte Alternative werden.
Damit der Durchbruch gelingt, sind massive Investitionen nötig – sowohl in die Infrastruktur als auch in Forschung und Entwicklung. Langfristig könnte Wasserstoff insbesondere in Sektoren eine entscheidende Rolle spielen, in denen Elektrifizierung an ihre Grenzen stößt. Dazu gehören unter anderem die Stahlproduktion, die Chemieindustrie oder der internationale Schiffs- und Flugverkehr. Voraussetzung dafür ist jedoch ein entschlosseneres Handeln von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Andernfalls bleibt die Wasserstoffwende ein vielversprechendes Konzept ohne echte Umsetzung.